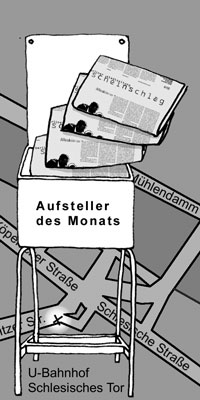|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|

„Kämpfe für dein Haus, kämpfe für dein Viertel"Die Wohnraumbewegung in BarcelonaIn Barceloneta, formal ein Innenstadtviertel, ist immer noch etwas von der Vergangenheit des früheren Fischerdorfes zu spüren. Die Geschäftigkeit in den engen Straßen ist weniger mondän und aufgekratzt als in den anderen Innenstadtbezirken Barcelonas. Doch an diesem Freitagabend wird die fast kleinstädtische Beschaulichkeit unterbrochen: Trillerpfeifen, Topfdeckel und wütende Stimmen sind zu hören. Ein paar hundert Menschen haben sich am zentralen Platz des Viertels versammelt. Viele ältere Leute sind darunter. Kämpferische Parolen werden gerufen: „Kämpfe für dein Haus, kämpfe für dein Viertel." Oder: „Spekulation ist keine Mitbestimmung!" Die Angst, aus ihrem Viertel, in dem viele seit Jahrzehnten leben, vertrieben zu werden, läßt die Menschen hier zusammenkommen und demonstrieren. Vorbei an schick umgebauten Marktgebäuden, deutlichen Zeichen der neuen Entwicklung. Der Demozug bewegt sich lautstark durch die Straßen, wird von Gesten der Zustimmung begrüßt. Etwa vom Kellner eines Straßencafés, der Töpfe und Pfannen aus der Küche holt, um spontan mit einzustimmen. Der Zug endet am Gebäude der Stadtverwaltung, deren Planungen Grund des Protestes sind. Auf Schildern steht „Barceloneta ist Rebellion" mit einem vom Blitz in zwei Hälften gespaltenen Herzen als Symbol. Eine Anspielung auf das Symbol der Imagekampagne „Barcelona, pulsierende Stadt". Denn für die Bewohner Barcelonetas und vieler anderer Stadtteile bedeutet der Pulsschlag der Stadtentwicklung eine völlige Veränderung ihrer Viertel, in denen für sie dann oftmals kein Platz mehr ist. „Wenn mein Mietvertrag ausläuft, weiß ich nicht mehr, wohin", erzählt eine Frau verzweifelt, „bezahlbarer Wohnraum ist im Innenstadtbereich von Barcelona kaum noch zu finden." Ironischerweise wurde das Sanierungskonzept der Stadtverwaltung für Barceloneta aufgrund von Wünschen aus der Nachbarschaft ins Leben gerufen. Viele Senioren wollen ihren Lebensabend in ihrer gewohnten Umgebung verbringen und forderten deshalb die Schaffung von mehr auf sie zugeschnittenen Wohnraum im Quartier. Zwar wurde der flächendeckende Einbau von Aufzügen in fast allen Häusern im Stadtteil beschlossen, zur Umsetzung in diesem eng bebauten Areal müssen jedoch vielerorts Häuser entkernt oder ganz abgerissen werden. „Dies ist ein typisches Beispiel, wie Forderungen aus Nachbarschaften aufgegriffen, aber für gänzlich andere Zwekke funktionalisiert werden", sagt Silvio*. Dem Aktivisten der Hausbesetzerbewegung ist es wichtig, sich mit den Kämpfen von Mietern zu solidarisieren. „Natürlich geht es nur vordergründig darum, in Barceloneta altengerechten Wohnraum zu schaffen. Der Umbau macht den Stadtteil attraktiv für eine einkommensstarke Klientel, die es schick findet, in solch einem Viertel in der Innenstadt zu wohnen." Pilar* lebt in einem besetzten Haus im benachbarten Stadtteil und ist Aktivistin gegen Stadtumstrukturierung. „Mit Barceloneta würde der letzte Stadtteil Barcelonas in Küstennähe umstrukturiert", ergänzt sie. Bei der Arbeit mit den Bewohnern der betroffenen Quartiere ist ihr wichtig, die Strukturen, die hinter solchen Prozessen stecken, aufzudecken. Strategien entlarven„Wichtig ist, die Propaganda der Stadtverwaltung zu entlarven, die soziale Gründe vorgibt, um den Menschen in den Vierteln ihre Stadtentwicklung schmackhaft zu machen." Daß dem nicht so ist und statt dessen oft Verdrängung der alteingesessenen Bewohnerschaft und Zerstörung sozialer Netzwerke die Folgen sind, dafür gibt es in der Stadt Beispiele genug. So wurden beim Umbau Barcelonas für die Olympischen Spiele 1996 ganze Stadtteile abgerissen. Andere, denen dieses Schicksal erspart blieb, wurden einem drastischen Imagewandel unterzogen. So wurde das innerstädtische Quartier „Barrio Chino" (Hurenviertel) vor den Olympischen Spielen kurzerhand in den unverfänglichen Namen „el Raval" umbenannt. In den darauffolgenden Jahren gab es weitere Projekte, die der Unkontrollierbarkeit dieses Stadtteils mit seinen engen Straßen, der multikulturellen Bevölkerung sowie einer blühenden Schattenwirtschaft und Prostitution den Kampf ansagten. Frei nach Baron Haussman wurden Schneisen ins Dickicht der Häuserblökke und Gassen geschlagen, um kontrollierbare Plätze zu schaffen. „Mehr Licht und Raum" hieß die Begründung aus dem Rathaus. Zusätzlich wurde durch Ansiedlung renommierter Kultureinrichtungen das Image des Viertels als Kulturstandort und Szeneviertel geprägt. Bezahlbaren Wohnraum gibt es auch hier kaum noch, dafür schießen in immer mehr Straßen Designershops und Bars wie Pilze aus dem Boden. „Ich fühle mich in meinem Viertel wegen der Massen von hippen Modemenschen, die seit einigen Jahren mehr und mehr durch meine Straße ziehen, nicht mehr zuhause", erzählt eine langjährige Bewohnerin des Viertels. Sie denkt ans Wegziehen. Der Stadtteil Poble No, der geprägt ist von einer Mischung aus kleineren Fabriken, Handwerksbetrieben und einfachen Wohnhäusern, wird zur Zeit schrittweise dem Erdboden gleichgemacht, es entstehen sterile Wohnblocks oder Bürogebäude. Dabei bietet die Übergangszone von den bereits neu errichteten Straßenzügen zu den noch erhaltenen Teilen des Quartiers ein gespenstisches Bild: kahlrasierte Flächen, auf denen kürzlich noch Häuser standen, dazwischen noch ein paar verloren dastehende Gebäude, vor denen die Abrißbirne schon steht. In Silvios Viertel La Ribera schufen Anwohner „el Foret de Vergonia", was so viel wie „Wald der Schande" bedeutet. Dieser Nachbarschaftsgarten wurde auf einer Fläche, die nach dem Abriß von Wohnhäusern mit insgesamt über tausend Wohnungen entstanden war, gemeinsam mit Aktivisten aus den benachbarten besetzten Häusern geschaffen. Hier sollte für 16 Millionen Euro ein Park entstehen. Aus Protest gegen die Kahlschlagsanierung und autoritäre Planung bepflanzten die Anwohner die Fläche in Eigenregie und schufen einen sozialen Treffpunkt für das Viertel. So existierte lange Zeit ein Mahnmal gegen die herrschende Planungspolitik. Ein Ultimatum der Stadtverwaltung, verbunden mit einem Kompromißvorschlag, beendete das Projekt. Aus Protest gegen den Kompromiß, in dem nur wenig vom Konzept der Bewohner übrig geblieben wäre, entfernten diese ihre Pflanzen, bevor die Bauarbeiter kamen. Teilweise werden nach Abrissen von alten Häusern auch Sozialwohnungen errichtet, doch „die sind oft in billiger und schlechter Qualität gebaut und nur für einige Jahre als sozialer Wohnungsbau gebunden", bemerkt Pilar. Es sind nur halbherzige Projekte angesichts des Mangels an bezahlbarem Wohnraum. Dies und die allgegenwärtige Wohnraumspekulation führten dazu, daß mittlerweile die Wohnraumbewegung zu einer wichtigen politischen Größe geworden ist. Kontakt suchenAuf den Demonstrationen kommen zehntausende Menschen zusammen. Ähnlich wie in Frankreich kann die Regierung das Problem nicht mehr negieren und kündigt Abhilfe an. Einfache Schuldzuweisungen an der Misere werden dabei gleich mitgeliefert: „Zur Zeit wird eine Kriminalisierungskampagne gegenüber der Hausbesetzerbewegung gestartet, um so die Bewegung zu spalten: Der Wohnraumbewegung wird versprochen, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und der Besetzerbewegung wird die Schuld am Wohnungsmangel zugeschoben, da angeblich durch Besetzungen Bauvorhaben blokkiert und somit die Schaffung von Wohnraum verhindert wird", erklärt Pilar. In Barcelona gibt es eine sehr aktive Hausbesetzerbewegung. In den letzten Monaten wurden verstärkt Häuser geräumt. Die Stadtverwaltung richtete zudem ein Büro ein, über das sich Besitzer besetzter Gebäude Beratung für ihre Räumungsverfahren holen können. Die besetzten Häuser bieten aber nicht nur vielen Menschen Raum zum Wohnen, sie sind auch wichtige Orte für politische und soziale Bewegungen. Wie das kürzlich geräumte Frauenzentrum Mambo. „Das war ein Ort für Frauen mit verschiedenen gesellschaftlichen Hintergründen, die sich hier treffen konnten. Sie hatten einen Schutzraum vor dem alltäglichen Machismo und konnten hier gemeinsam Aktionen zum Beispiel zu Gewalt gegen Frauen planen", erzählt Andrea. Die Berlinerin lebt zur Zeit in Barcelona und ist aktiv in der Mambo Gruppe. „Das Haus wurde illegal, also ohne entsprechende Vorankündigung, geräumt und so was kommt leider immer öfter vor." Auch Silvio und Pilar stellen mehr Repression in der Stadt fest. Lange Zeit pflegte Barcelona ein Image als Stadt der sozialen Experimente und umwarb zum Beispiel gezielt Jugendkulturen wie die Skater. „Aber das hat der Tourismusindustrie nicht genug Geld in die Kassen gebracht", mutmaßt Pilar, und Silvio ergänzt: „Jetzt setzt die Stadt mehr auf eine einkommensstärkere Klientel, der Ordnung und Sauberkeit sehr wichtig ist." Tourismus ist eine der Haupteinnahmequellen der Stadt. Mit einem neuen Gesetz, dem „Civisme", was so viel wie Stadtbürgertum bedeutet, wird versucht, ein Image einer von einem stolzen Bürgertum sauber und ordentlich gehaltenen Kommune zu schaffen. Erinnerungen an die Berliner „Urbaniten", die neuen Stadtbürger, die alles richten sollten, drängen sich auf. Der „Civisme" kriminalisiert mit seinen Verordnungen alles, was diesem Image schaden könnte: von Straßenhandel über Alkoholkonsum auf der Straße sowie Prostitution bis hin zum Skaten. Pilar ist es bei der politischen Arbeit wichtig, alle von einer solchen Entwicklung betroffenen Gruppen mit einzubeziehen. Sie verbrachte längere Zeit in Deutschland und war oft enttäuscht über die separatistische Haltung der linken Aktivistenszene. „Die Strukturen in Deutschland sind sehr gut, aber oft habe ich den Eindruck, viele wollen letztendlich nicht wirklich was verändern, weil sie nicht wirklich die Berührung mit Menschen, die außerhalb ihrer definierten Szenestrukturen sind, suchen." Die Auseinandersetzung mit Menschen innerhalb einer Kampagne wie derjenigen in Barceloneta, die oft andere Lebensentwürfe und inhaltliche Schwerpunkte hätten, sei anstrengend, aber auch wichtig, wenn einem das Anliegen ernst sei, betont sie. Auch wenn es nicht völlig gelungen sei, die Umwandlung der Stadtteile zu verhindern, habe der Protest als Sand im Getriebe diesen Prozeß oft lange hinauszögern und abschwächen können. Und so meint Silvio hoffnungsvoll: „Der gemeinsame Kampf gegen diese Entwicklung schuf neue Freiräume: Etwa als Anwohner vor einigen Jahren im Rahmen des Widerstandes gegen die Umgestaltung ihres Viertels eine alte Villa besetzten." Diese Villa steht immer noch, genutzt als selbstverwaltetes Stadtteilzentrum für alle Bewohner der Viertels. Michael Philips * Name geändert Fotos: Michael Philips
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||